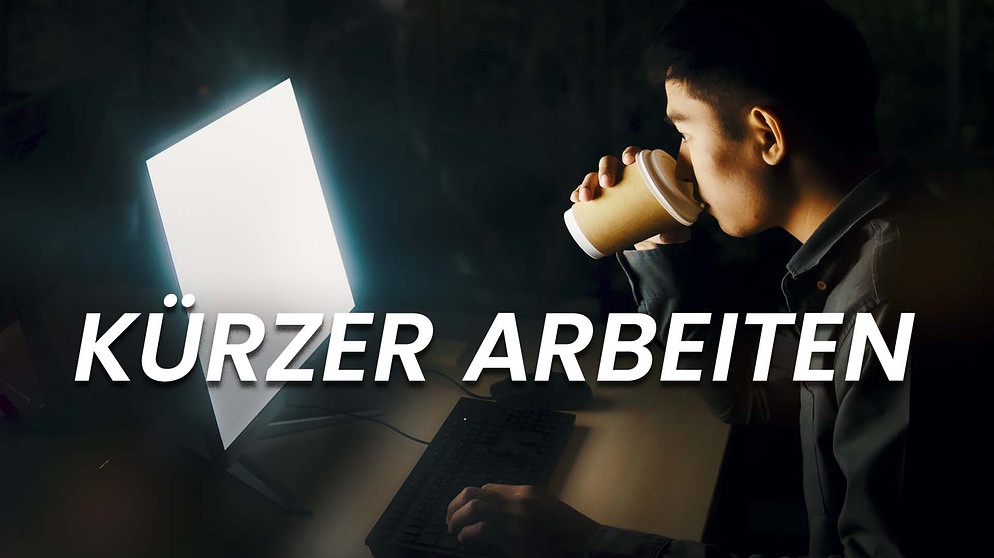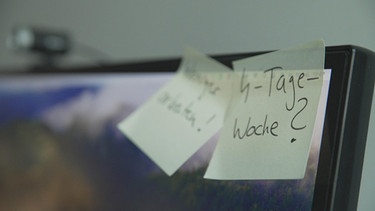New Work Arbeiten wir mit der 4-Tage-Woche produktiver und gesünder?
Vier-Tage-Woche, also drei Tage frei: Das klingt verführerisch. Studien zeigen, dass sich so nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Produktivität verbessern kann. Was spricht dafür und was dagegen?
Verkürzte Arbeitswoche: Weniger Stress, gleiche Produktivität

4-Tage-Woche bei gleicher Bezahlung: 40 Stunden verteilt auf vier Tage oder 32 Wochenarbeitsstunden bei gleichem Arbeitspensum.
Bei einer 4-Tage-Woche - mit gleicher Bezahlung wie bei fünf Arbeitstagen - gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen: Bei Modell eins werden die üblichen 40 Regelstunden einfach auf vier Tage umverteilt, sodass unter dem Strich vier 10-Stunden-Arbeitstage stehen. Das zeigt zwar, wie in der Arbeitswelt mehr Flexibilität gedacht werden kann, Arbeitsforscher raten aber davon ab, die Stunden auf diese Weise zu bündeln. Denn das kann unter anderem gesundheitsschädlich sein.
Modell zwei verfolgt den sogenannten flexiblen 100-80-100-Ansatz. Das heißt, dass für 80 Prozent der bisherigen Arbeitszeit 100 Prozent des Gehalts ausgezahlt wird. Trotzdem wird eine hundertprozentige Produktivität erwartet. Eine großangelegte Umfrage zu diesem Modell wurde von Juni bis Dezember 2022 im Vereinigten Königreich durchgeführt. Daran nahmen 61 Unternehmen und rund 2.900 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teil. Die Ergebnisse verdeutlichen: 39 Prozent der Mitarbeiter fühlten sich durch den 100-80-100-Ansatz weniger gestresst, 71 Prozent wiesen am Ende der Studie ein geringeres Burnout-Niveau auf. Auch Angstzustände, Müdigkeit und Schlafprobleme gingen zurück.
Von den 61 Unternehmen hielten ein Jahr nach der Untersuchung 54 an der Vier-Tage-Woche fest. Dass das Beispiel aus Großbritannien kein Einzelfall ist, zeigt sich unter anderem in Island, wo verkürzte Arbeitszeiten nach einer Testphase in den Jahren 2015 bis 2019 mittlerweile gesetzlich verankert sind. In Deutschland läuft seit dem 1. Februar 2024 die bisher größte heimische Pilotstudie zur 4-Tage-Woche, an der knapp 50 Unternehmen teilnehmen. Wissenschaftlich begleitet wird das Experiment von der Universität Münster.
Video: Wie uns die 4-Tage-Woche in Zukunft verändert
Arbeitsforschung: Belegschaft bei 4-Tage-Woche einbeziehen
"Im Fall der Großbritannien-Studie glaube ich, dass die Ergebnisse total plausibel sind. Letzten Endes geht es darum, der Belegschaft etwas Gutes zu tun. Das soll die Arbeitsfähigkeit und die Bindung an das Unternehmen stärken. Eine gewisse Freiwilligkeit muss da immer erhalten bleiben. Bei solchen Prozessen der Umstrukturierung in Unternehmen sollte die Belegschaft aber mit eingebunden werden."
Dr. Hannah Schade, Arbeitspsychologin vom Leibniz-Institut Dortmund
Video: Der Traum von der 4-Tage-Woche
4-Tage-Woche: Positive Effekte
Mitarbeiter:
- Wohlbefinden: Stress nimmt ab, das Burnout-Risiko sinkt und die Schlafqualität nimmt zu.
- Work-Life-Balance: Freizeit, Familie und Beruf werden besser vereinbar.
- Gleichberechtigung: Aufgabenverteilung kann gerechter gestaltet werden, bei Familien besonders im Haushalt.
Unternehmen:
- Kosteneffizienz: Arbeitsprozesse werden kreativ optimiert und Bürokosten reduzieren sich.
- Betriebsgesundheit: Weniger Fehlzeiten bedeuten mehr planbare Arbeitskraft.
- Attraktivität: Unternehmen können bei der Anwerbung von Fachkräften durch eine flexible Arbeitszeitgestaltung punkten.
Work-Life-Balance: Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten
Der Anteil von Teilzeitbeschäftigten steigt in Deutschland kontinuierlich an. Aber auch für Vollzeitbeschäftigte wird die Vorstellung einer 4-Tage-Woche immer attraktiver: 81 Prozent würden sie sich wünschen - vorausgesetzt, dass es sich um eine echte Reduktion handelt und an den verbliebenen Tagen keine Mehrarbeit anfällt. Das ergab eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung im Jahr 2022, deren Ergebnisse repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung sind. Die Untersuchung basiert auf Daten von 2.575 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Vollzeit arbeiten und vertraglich geregelte Arbeitszeiten haben. Eine weitere Bedingung wäre für viele ein gleichbleibender Lohn. Nur 8 Prozent der Befragten würden dafür auch weniger Gehalt in Kauf nehmen. Eine 4-Tage-Woche nach diesem Modell erfordere Anpassungen hinsichtlich Arbeitsmenge und -aufteilung, so die Studienautoren Yvonne Lott und Eike Windscheid. Auch verbindliche Vertretungsregelungen, mehr Personal und eine geregelte Erreichbarkeit seien dafür unter anderem notwendig. Und: Sollten künftig mehr Menschen 4 Tage die Woche arbeiten, dann bräuchte es auch mehr und verlässliche Kinderbetreuung.
Interview: Was gilt arbeitsrechtlich bei der 4-Tage-Woche?
Wenn ihr nach einem Modell der 4-Tage-Woche arbeiten wollt, gibt es einiges zu beachten: Welche Auswirkungen hat die 4-Tage-Woche für eure Rente? Wie könnt ihr sie mit eurem Arbeitgeber vereinbaren und was geschieht an Feiertagen, bei Krankheit und im Urlaub, welche Ansprüche habt ihr?
Auf diese und weitere Fragen antwortet Dara Horwath, Rechtsberaterin der Handwerkskammer Region Stuttgart im ARD alpha-Interview.
ARD alpha: Welche Arbeitszeitmodelle gibt es bei einer 4-Tage-Woche?
Horwath: Wenn man zurzeit von einer 4-Tage-Woche spricht, ist in der Regel eines dieser Modelle gemeint:
Modell eins: Vier Tage arbeiten bei reduzierter Wochenarbeitszeit und weniger Gehalt.
Modell zwei: Vier Tage arbeiten bei gleichbleibender Wochenarbeitszeit und vollem Gehalt.
Modell drei: Vier Tage arbeiten bei reduzierter Wochenarbeitszeit und vollem Gehalt.
ARD alpha: Sind die Modelle eins und drei Teilzeitmodelle?
Horwath: Im Grunde handelt es sich bei den Modellen eins und drei um Teilzeitmodelle, weil hier eine Arbeitszeitreduzierung zugrunde liegt.
ARD alpha: Was bedeutet die 4-Tage-Woche für meine Rente?
Horwath: Die Rente hängt von der Verdiensthöhe ab, nicht von der Arbeitszeit. In den Modellen zwei und drei würde es keine Änderungen bei der Rente geben, im Modell eins würde sie geringer ausfallen. In diesem Fall sollte sich der Arbeitnehmer vorher mit der Deutschen Rentenversicherung in Verbindung setzen und sich über die konkreten Auswirkungen informieren.
ARD alpha: Wie wird die 4-Tage-Woche vereinbart und entscheidet der Arbeitgeber, ob ich vier Tage arbeiten darf?
Horwath: Die Vereinbarung zur 4-Tage-Woche sollte wie jede andere Vereinbarung schriftlich getroffen werden. Die Entscheidung zur Einführung einer 4-Tage-Woche trifft vom Grundsatz her zunächst der Arbeitgeber. Ob und wie diese Entscheidung tatsächlich umsetzbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da das Arbeitszeitmodell eins auch durch eine Verringerung der Arbeitszeit nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz erzielt werden kann, kann die Entscheidung zur 4-Tage-Woche in diesem Fall auch vom Arbeitnehmer ausgehen.
ARD alpha: Welche Einschränkungen gibt es?
Horvath: Anwendbare Tarifverträge können der Einführung einer 4-Tage-Woche entgegenstehen, wenn sie zum Beispiel die Wochenarbeitszeit und die konkrete Verteilung der Wochenstunden verbindlich festlegen. Gibt es einen Betriebsrat, wäre er außerdem zwingend zu beteiligen. Der Betriebsrat hat zum Beispiel nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes ein Mitbestimmungsrecht bei der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage und der Frage, an wie vielen Tagen in der Woche gearbeitet werden soll.
ARD alpha: Habe ich ein Anrecht auf eine 4-Tage-Woche?
Horwath: Als Arbeitnehmer habe ich unter bestimmten Voraussetzungen nur einen Anspruch auf das Arbeitszeitmodell eins, weil es sich dabei eigentlich um eine klassische Teilzeittätigkeit, wie zum Beispiel im Sinne des § 8 und 9a des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, handelt. Ein Rechtsanspruch auf eine 4-Tage-Woche nach den Modellen zwei und drei besteht nicht.
ARD alpha: Darf der Arbeitgeber von sich aus eine 4-Tage-Woche mit einer Arbeitszeitreduzierung einführen?
Horwath: Der Arbeitgeber kann die vereinbarte Arbeitszeit nicht durch eine einseitige Anordnung reduzieren. Eine Arbeitszeitreduzierung kann nur einvernehmlich oder über eine Änderungskündigung erfolgen. Die Verteilung der vereinbarten Arbeitszeit auf vier Arbeitstage kann der Arbeitgeber aber grundsätzlich einseitig im Rahmen seines Direktionsrechts anordnen, wenn die Vergütung nicht angetastet wird.
Soll auch die Vergütung reduziert werden, oder wurde im Arbeitsvertrag bereits eine andere Verteilung vereinbart, braucht der Arbeitgeber die Zustimmung des Arbeitnehmers oder er muss dies per Änderungskündigung durchsetzen. Das alles gilt nicht, wenn in einem anwendbaren Tarifvertrag, oder in einer Betriebsvereinbarung, Regelungen zur Arbeitszeit und ihrer Verteilung auf einzelne Wochentage enthalten sind, die zwingend zu berücksichtigen sind.
ARD alpha: Und wenn nicht alle Mitarbeiter eine 4-Tage-Woche wollen?
Horwath: Kann der Arbeitgeber die 4-Tage-Woche im Rahmen seines Direktionsrechts einseitig anordnen, muss der Arbeitnehmer die neue Verteilung der Arbeitszeit grundsätzlich akzeptieren. Bei der Ausübung seines Direktionsrechts ist der Arbeitgeber allerdings an 'billiges Ermessen' gebunden, er muss zum Beispiel auf eine Behinderung des Mitarbeitenden Rücksicht nehmen. Kann der Arbeitgeber die 4-Tage-Woche nicht einseitig anordnen und verweigert der Arbeitnehmer die Zustimmung, kommt nur eine Änderungskündigung in Betracht, die aber an hohe rechtliche Hürden geknüpft ist.
ARD alpha: Muss der Arbeitgeber die 4-Tage-Woche für alle erlauben oder kann er sie auch nur einzelnen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen gewähren?
Horwath: Nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz ist eine willkürliche Schlechterstellung einzelner Arbeitnehmer gegenüber anderen vergleichbaren Arbeitnehmern unzulässig. Abweichende Regelungen sind, auch im Hinblick auf die Vereinbarung einer 4-Tage-Woche, nur dann zulässig, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt.
ARD alpha: Was geschieht an Feiertagen, bei Krankheit und im Urlaub? Welche Ansprüche habe ich?
Horwath: Der Urlaubsanspruch wird nach der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage bestimmt. Wird nur noch an vier Tagen in der Woche gearbeitet, wird die Anzahl der Urlaubstage, entsprechend anteilig gekürzt. Im Ergebnis macht das aber keinen Unterschied, weil der Arbeitnehmer trotz der reduzierten Anzahl an Urlaubstagen gleich lang frei hat.
Bei Feiertagen und bei Krankheit gilt: Sind die Wochenarbeitstage genau festgelegt, und fällt auf einen dieser Arbeitstage ein Feiertag oder Krankheitstag, ist der Arbeitnehmer nicht zur Nacharbeit an einem arbeitsfreien Tag verpflichtet. Anders ist es, wenn die Verteilung der Arbeitstage flexibel gestaltet ist. Allerdings muss dem Mitarbeiter die Planung immer rechtzeitig mitgeteilt werden.
ARD alpha: Müssen bei der 4-Tage-Woche bestimmte Arbeitsstunden pro Tag eingehalten werden ?
Horwath: Das Arbeitszeitgesetz sieht eine werktägliche Arbeitszeit von bis zu acht Stunden vor. Sie kann aber im Regelfall auf maximal zehn Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.
ARD alpha: Gibt es bestimmte Personen die von einer Arbeitszeit von zehn Stunden pro Tag ausgenommen sind?
Horwath: Gesetzliche Einschränkungen gelten für werdende und stillende Mütter oder für Jugendliche, für die die strengeren Regelungen des Mutterschutzgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes greifen. Schwerbehinderte, und diesen Gleichgestellte, können zwar mehr als acht Stunden werktäglich beschäftigt werden, allerdings nicht gegen ihren Willen (§ 124 SGB IX).
ARD alpha: Darf ich bei einer 4-Tage-Woche Überstunden machen?
Horwath: Wenn es keine abweichende Regelung in einem anwendbaren Tarifvertrag gibt, können bei einer werktäglichen Arbeitszeit von zehn Stunden an den vier Arbeitstagen keine Überstunden angeordnet werden, weil sonst die Höchstarbeitszeit nach § 3 des Arbeitszeitgesetzes überschritten wäre. Reizt der Arbeitgeber seinen Spielraum bei der werktäglichen Höchstarbeitszeit aus, muss der Arbeitnehmer nach Ablauf der zehn Stunden seine Tätigkeit umgehend einstellen, auch wenn er vielleicht nur noch zehn Minuten brauchen würde, um die Arbeit abzuschließen.
ARD alpha: Kann ich auch wieder zurück zur 5-Tage-Woche wechseln?
Horwath: Auch hier gilt: Konnte der Arbeitgeber die 4-Tage-Woche einseitig per Direktionsrecht einführen, kann er auch wieder einseitig zur 5-Tage-Woche zurückkehren. Bei einer einvernehmlichen Vereinbarung der 4-Tage-Woche ist wieder eine einvernehmliche Vereinbarung der Parteien notwendig. Beruht im Modell eins die Arbeitszeitreduzierung auf einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage, wie zum Beispiel bei einer Brückenteilzeit nach § 9a des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, können für die erneute Aufstockung der Arbeitszeit besondere Regeln gelten.
ARD alpha: Kann ich selbst bestimmen, an welchem Tag ich in der 4-Tage-Woche frei habe?
Horwath: Welcher Tag frei ist, bestimmt der Arbeitgeber, wenn die Anordnung auf Grundlage seines Direktionsrechtes erfolgt. Bei einer einvernehmlichen Änderung der Arbeitszeit ist das Verhandlungssache.
Video: Lieber Freizeit statt Karriere
Weniger Arbeitsstunden: Ist die Umsetzung realistisch?

Forschende diskutieren, ob es möglich ist, auch im Gesundheitsbereich, in Krankenhäusern und in der Pflege, die 4-Tage-Woche einzuführen.
Die verkürzte Arbeitswoche birgt Herausforderungen. So muss der Arbeitgeber zunächst sicherstellen, dass die Arbeit gleichmäßig aufgeteilt wird. Hannah Schade sagt dazu: "Mit dem Gedanken, die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit schaffen zu wollen, kann auch mehr Stress einhergehen. Und das bedeutet, dass dieser Umstrukturierungsprozess unbedingt eingehend begleitet werden muss."
Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf den demografischen Trend in Deutschland. Es werde in Zukunft deutlich weniger Arbeitskräfte geben, sagt Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Daher könne nicht die Lösung sein, weniger zu arbeiten. Stattdessen müsse mehr geschuftet werden, um den Personalmangel zu kompensieren. In bestimmten Branchen, wie im Gesundheits- und Pflegebereich, lasse sich die Produktivität sowieso nicht derart steigern, dass eine Arbeitszeitverkürzung auf vier Tage ausgleichsfähig sei.
Gesagt: Ideologische Gräben überwinden
"Arbeitgeber führen die 4-Tage-Woche ja auch ein, weil sie sich eine größere Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt, also im Konkurrenzkampf um Arbeitnehmer, erhoffen. Dementsprechend ist denkbar, dass mehr Menschen sich für einen derartigen Beruf, zum Beispiel im Gesundheitssektor, begeistern können. Ich bin also zuversichtlich, dass das in Deutschland überall geht, vielleicht aber nicht sofort. Was mich jedenfalls überrascht, ist, wie ideologisch die Diskussion teils geführt wird."
Dr. Hannah Schade, Arbeitspsychologin vom Leibniz-Institut Dortmund
Weniger arbeiten: Mehr Klimaschutz?

Forschende sehen in der 4-Tage-Woche eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Positiv auswirken könnte sich das Modell der 4-Tage-Woche auch auf den Klimawandel. Den exakten Nutzen für das Klima zu messen, ist zwar schwierig, laut einer Studie aus dem Jahr 2012 aber führt eine Reduzierung der Arbeitsstunden um 10 Prozent bereits zu einer Senkung des individuellen CO2-Fußabdrucks um 8,6 Prozent. Die Ergebnisse machen also klar, dass die Arbeitszeit hier ein Faktor sein kann. Die Studienautoren sehen jedoch eine Verringerung des Bruttoinlandprodukts, und damit der Produktivität, durch Senkung der Arbeitszeit als ein noch wesentlich effektiveres Mittel an.
Dass die dazugewonnene Freizeit wiederum verstärkt für CO2-intensive Tätigkeiten genutzt werden könnte, darf nicht außer Acht gelassen werden. Eine Nature-Studie konnte jedoch zeigen, dass Menschen in Nordamerika und Europa an Wochenenden einen geringeren Kohlendioxidausstoß haben als unter der Woche (für den ostasiatischen Raum lässt sich keine signifikante Verringerung nachweisen). Das könnte zumindest einen ersten Hinweis darauf geben, dass die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlängerte Wochenenden nicht zwangsläufig für mehr Autofahrten und mehr klimaschädliche Wochenendtrips per Billigflieger nutzen würden. Genauere Auswertungen gibt es aber noch nicht.
Video: Ist es an der Zeit für neue Arbeitsmodelle?
Mehr Wissen: Quellen und Sendungen zum Thema 4-Tage-Woche
- Umfrage zur 4-Tage-Woche (Hans-Böckler-Stiftung)
- Arbeitszeitreport Deutschland 2021 (BAuA)
- Großbritannien: Das bringt die 4-Tage-Woche (Autonomy, in engl. Sprache)
- So viel CO2 werden am Wochenende ausgestoßen (Nature, in engl. Sprache)
- Herzkrankheiten durch langes Arbeiten (WHO, in engl. Sprache)
- Wie weniger Arbeit das Klima beeinflusst (BBC, in engl. Sprache)
- Work-Life-Balance: Sollten wir weniger arbeiten? (Quarks)
- "Vier-Tage-Woche - Wie arbeiten wir in Zukunft?": Gut zu wissen, ARD alpha, 24.10.2024, 10.45 Uhr
- "Vier-Tage-Woche - Wie arbeiten wir in Zukunft?": Gut zu wissen, BR, 20.10.2024, 06.00 Uhr
- "Die positiven Effekte der 4-Tage-Woche sind nachhaltig": Daily Good News, COSMO, 26.02.2024
- "Weniger Arbeit, mehr Leben, gleiches Geld? Die 4 Tage Woche im Pilotprojekt": Newsjunkies, rbb24 Inforadio, 01.02.2024
- "Vier Tage sind genug: Kürzer arbeiten, mehr schaffen!": Der Tag, hr, 30.01.2024, 18.05 Uhr
- "Revolution in der Arbeitswelt? Wie die 4-Tage-Woche den beruflichen Alltag verändert": Geld, Markt, Meinung, SWR2, 13.01.2024, 12.15 Uhr
- "Vier-Tage-Woche: Macht das wirklich glücklicher?": reporter, funk, 11.12.2023
- "4-Tage-Woche nichts für unterfränkische Industrie?": Frankenschau aktuell, 10.10.2023, 17.30 Uhr
- "4-Tage Woche: Die Lösung gegen Burn-Out?": Deutschland3000 - Die Woche mit Eva Schulz, SWR, 18.05.2023
- "Der Traum von der 4-Tage-Woche: Würde das in Ihrem Job funktionieren?": Tagesgespräch, ARD alpha, 12.05.2023, 12.05 Uhr
- "Vier-Tage-Woche - Was bringen neue Arbeitszeitmodelle?": mehr/wert, BR Fernsehen, 04.05.2023, 19:00 Uhr
- "Arbeitszeit-Modell: Pro und Contra 4-Tage-Woche": BR24 16:00, BR24, 04.04.2023, 16.00 Uhr
- "Vier Tage Arbeit, drei Tage frei - Wunschdenken oder Zukunftsmodell?": Fakt ist!, MDR Fernsehen, 20.03.2023, 22:10 Uhr.
- "Vier-Tage-Woche: Wie macht sich der Wunschtraum in der Realität?": Abendschau, BR Fernsehen, 16.03.2023, 18:00 Uhr
- "4-Tage-Woche?!": Abendschau, 10.03.2023, 18.00 Uhr
- "Vier-Tage-Woche-im-Handwerk: Funktioniert das?": Live nach Neun, Das Erste, 07.03.2023, 09:05 Uhr
- "beta stories - So funktioniert die 4-Tage-Woche": Gut zu Wissen, ARD alpha, 06.03.2022, 16.30 Uhr
- "Wie uns die 4-Tage-Woche in Zukunft verändert": beta stories, BR Fernsehen, 05.03.2022, 19.00 Uhr